RöMa
Röntgengitterspektrometer mit Mandreloptik für sehr hohe Nachweisempfindlichkeit leichter Elemente
Projektträger
Kofinanzierung
Investitionsbank Berlin

Projektpartner
NOB Nano Optics Berlin GmbH

PREVAC
Präzisionsmechanik
und Vakuum GmbH

Institut
für angewandte Photonik e.V.
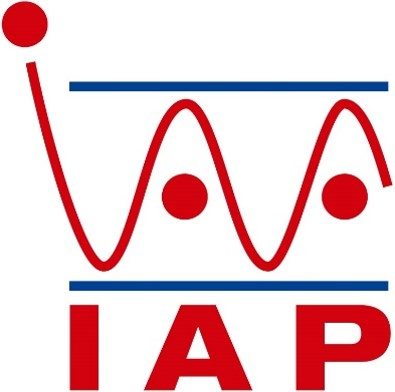
Laufzeit
Start : 01.08.2023
Ende: 31.07.2026
Ziel
Das Gesamtziel besteht darin, ein neuartiges Röntgengitterspektrometer für den extremen Ultraviolett- (XUV) und den weichen Röntgenbereich mit einer sehr hohen Nachweisempfindlichkeit für leichte Elemente wie Lithium (Li) und Bor (B) zu erforschen, aufzubauen und in Proof-of-principle-Experimenten zu testen. Erste Vorbetrachtungen weisen auf sehr vielversprechende Möglichkeiten hin, im Vergleich zu den derzeit angebotenen Geräten die Zahl der nachgewiesenen Photonen durch Vergrößerung des erfassten Raumwinkels um ein bis zwei Größenordnungen zu erhöhen. Gleichzeitig kann die Intensität der störenden höheren Ordnungen, z. B. von Sauerstoff, durch Erhöhung der Reflexionswinkel um mehrere Größenordnungen vermindert werden. Zur Erhöhung des Raumwinkels wird im Projekt eine „Mandreloptik“ (MO) als Kondensor erforscht. Das ist der Teil eines innen verspiegelten Ellipsoiden, der von einem Mandrel abgeformt wird, also eine Replika.
Leistungsmerkmale
- E = (35 – 200) eV, mit separaten RZPs bis ca. 1000 eV
- Energieauflösungsvermögen (E/ΔE) ≈ 240 bei 72 eV
- Beugungseffizienz der RZP > 15 %
- Sensitivität < 1 % für Li in Verbindungen
- Raumwinkel, den die Optik erfasst: 0,2 sr für Li
- Kompaktes Instrument mit einer Gesamtlänge von (0,3 -1) m
Einsatzgebiet
- Einsatz der neuen Spektrometer an Rasterelektronenmikroskopen (REM) und
Elektronenstrahlmikroanalysatoren (ESMA) - Ortsaufgelöste Darstellung der Elementverteilung auf Oberflächen (Kathoden / Anoden). Von Li-Ionen-Batterien
- Bestimmung der Bor-Anteile in dotierten Halbleitern als wichtiges Einsatzgebiet der
Spektrometer in der Mikroelektronik und Chipherstellung.
Beschreibung
Im Rahmen des ProFIT-Verbundprojekts wird ein Röntgengitterspektrometer entwickelt, dessen Energieauflösungsvermögen so hoch sein soll, dass chemische Verschiebungen infolge der Molekülbildung der Li- und B-Elemente gemessen werden können. Das optische Element wird kundenspezifisch so gestaltet, dass das Gerät entweder für den Ein-Elemente-Nachweis ausgelegt wird oder einen größeren Energiebereich abdecken kann. Für die Bestimmung von Anteilen dieser leichten Elemente in einem Gemisch und der chemischen Verbindungen, in denen sie vorliegen, gibt es zurzeit keine geeigneten Geräte mit der erforderlichen Nachweisempfindlichkeit und dem Energieauflösungsvermögen. Damit eröffnet sich im Erfolgsfall ein großer Markt durch den Einsatz der neuen Spektrometer an Rasterelektronenmikroskopen (REM) und Elektronenstrahlmikroanalysatoren (ESMA). Diese haben wegen ihrer hohen Ortsauflösung und der damit möglichen Darstellung der Elementverteilung auf Oberflächen (Kathoden / Anoden) eine besondere Bedeutung für die aktuellen Forschungen zu modernen Energiespeichern, wie z. B. Li-Ionen-Batterien. Damit sind mit dem neuen Spektrometer einerseits ortsaufgelöste Messungen möglich, andererseits eröffnen sich weitere Einsatzbereiche im Bereich des Batterie-Recyclings. Die Bestimmung der Bor-Anteile in dotierten Halbleitern ist ein wichtiges Einsatzgebiet der Spektrometer in der Mikroelektronik und Chipherstellung. Eines der zentralen Projektziele ist die lokale Verfügbarkeit von Mandreloptiken, deren komplexe Herstellung erforscht und die als Demonstratoren gebaut werden. Bei erfolgreichem Abschluss des Projekts steht diese Technologie erstmals in Deutschland zur Verfügung. Bisher werden Mandreloptiken nur bei der NASA und weltweit in einigen wenigen Firmen gefertigt. Um ihr Potential für die geplanten Spektrometer voll auszunutzen, müssen sie an deren jeweilige Energiebereiche und optische Weglängen angepasst werden, wodurch erst anwendungsspezifische Geräte angeboten werden können. Mit der eigenen Herstellung von Mandreloptiken werden zudem die technologische Basis und die Fertigungstiefe von NOB erweitert und gleichzeitig mögliche Lieferkettenprobleme vermieden. Eine neue Generation von Reflexionszonenplatten (RZPs) wird den von der Mandreloptik ausgehenden Strahl auf einem ringförmigen Bereich reflektieren und dispergieren. Der Strahl wird auf den Detektor fokussiert. Dazu sind einerseits neue Rechenverfahren für die Struktur der 8 RZP erforderlich, da bisher nur divergente Strahlen benutzt wurden. Andererseits müssen neuartige Justageprozeduren erforscht werden, die die hochpräzise Ausrichtung von Mandreloptik, RZP und Kamera zueinander und zur Röntgenquelle gewährleisten.
In diesem Zusammenhang ist zu betonen, dass der hier genutzte Energiebereich der Röntgenstrahlung ein Spektrometerkonzept im Vakuum (HV/UHV) notwendig macht. Dies stellt gesteigerte Anforderungen an das Probenhandling, die Justage und die gesamte Instrumentierung. Zusammenfassend werden im Projekt das Spektrometer simuliert, die Herstellung der Mandreloptiken erforscht und diese als Demonstratoren hergestellt. Das neue Spektrometer wird im Rahmen der industriellen Forschung konstruiert und als Muster mit der Mandreloptik, einer speziell dafür entwickelten RZP und dem neuen Detektionssystem gebaut. Dieses Konzept weist somit eine Reihe von Alleinstellungsmerkmalen auf mit dem deutlichen Vorteil, dass die für die spätere Gerätefertigung erforderlichen Technologien und kritischen Baugruppen in der Region Berlin/Brandenburg zur Verfügung stehen und damit neue Arbeitsplätze geschaffen und nachhaltig gesichert werden können.
2. Meilenstein
Im Berichtszeitraum wurden theoretische und experimentelle Untersuchungen zur Wellenfront (WF)-Rekonstruktion durchgeführt. Dieser Wellenfront-Sensor wurde speziell für das gestellte Problem (Analyse der Mandrel-Optik) am IAP entwickelt wurde. Etablierte Methoden und fertige Programme zur WF-Rekonstruktion erwiesen sich im vorliegenden Fall als ungeeignet.

Die Algorithmen sind so weit entwickelt worden, dass am Wellenfront-Messplatz der Anteil des Justagefehlers am Wellenfrontfehler deutlich reduziert werden kann. Frühere Messungen ergaben einen Wellenfrontfehler (WFE) von ca. +/- 11λ0. Neue Messungen mit verbessertem Messplatz (höhere Einstellgenauigkeit) lieferten im Mittel 9.2λ0.
Dieser Wert ist zwar signifikant kleiner (allerdings geringere Statistik, es standen nur 24 % der ursprünglichen Datenmenge zur Verfügung) als der „alte“, aber von vergleichbarer Größenordnung. Da der Messplatz PREVAC zufolge wenigstens 10 x feinere Justage zulässt als das Vorgängermodell und die Messtoleranz des WF-Sensors („Algorithmen“) bei (0.1 – 1.0) l11λ0.iegt (eher 0.1), kann geschlossen werden, dass die Mandrel-Optik inzwischen wohl nahezu optimal justiert ist. Der gemessene Wellenfront-Fehler besteht folglich im Wesentlichen (90 % oder mehr) aus Figurenfehlern und der Justage-Anteil liegt bei max. 10 %.
Würde der Justagefehler z. B. bei 20 % liegen, hätte mechanische Feineinstellung den WFE weiter reduzieren können und die Algorithmen wären wegen oben erwähnter Messtoleranz in der Lage gewesen, diese Reduktion nachzuweisen.
Am Wellenfront-Messplatz können somit Messungen erfolgen, um die Mandreloptik mit einer angemessenen Genauigkeit zu charakterisieren. Damit wurde der 2. Meilenstein erfüllt.
